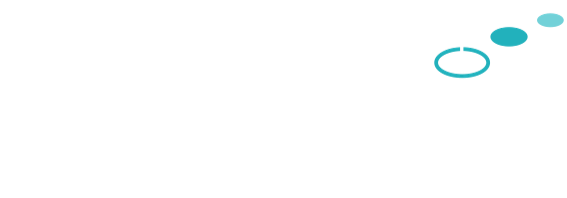Seit Februar müssen laut der KI-Verordnung alle Unternehmen, die Künstliche Intelligenz entwickeln oder nutzen, für ausreichende KI-Kompetenz bei ihren Mitarbeitenden sorgen. Verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen sorgen dafür, dass Mitarbeitende diese KI-Kompetenz erlangen.

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Um diesen neue Technologien einen rechtlichen Rahmen zu geben, ist im August 2024 die KI-Verordnung der EU in Kraft getreten (EU/2024/1689). Seit Februar 2025 ist nun Artikel 4 zur KI-Kompetenz wirksam. Demnach müssen alle Anbieter und Betreiber von KI-Systemen sicherstellen, dass alle Beschäftigte in ihrer Organisation, die KI nutzen, ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz besitzen. Was genau KI-Kompetenz ist, und wie sie vermittelt werden kann, davon berichtet dieser Beitrag.
Hintergrund: KI-Verordnung
Die Verordnung (EU) 2024/1689 (http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj )des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz wird allgemein als KI-Verordnung (KI-VO) bezeichnet. In ihr werden Regelungen zur Entwicklung und zum Einsatz sicherer und vertrauenswürdiger Systeme mit künstlicher Intelligenz (KI) innerhalb der Europäischen Union geregelt. Gleichzeitig wird die Gesundheit und die Sicherheit der EU-Bevölkerung und die Achtung der Grundrechte sichergestellt.
Als EU-Verordnung gilt sie direkt und unmittelbar für alle EU-Mitgliedsstaaten. Die KI-Verordnung Ist am 1. August 2024 in Kraft getreten. Allerdings wird der überwiegende Teil der Vorschriften erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam. Seit dem 2. Februar 2025 gelten bereits die Regelungen der Kapitel I und II, zu denen u.a. auch Artikel 4 zur KI-Kompetenz zählt. Einige Vorschriften werden erst ab dem 2. August 2025 gültig, wie z.B. zu Governance-Strukturen, Geldbußen oder zu Anbieterpflichten von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck; weiter Vorschriften erst zum 2. August 2026 und zum 2. August 2027.
Für uns interessant ist insbesondere der Artikel 4 KI-VO zur KI-Kompetenz:
Artikel 4 KI-VO:
KI Kompetenz„Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen, wobei ihre technischen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Ausbildung und Schulung und der Kontext, in dem die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, sowie die Personen oder Personengruppen, bei denen die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen sind.“
Was ist KI-Kompetenz?
KI-Kompetenz bezeichnet nach Art. 3 Nr. 56 EU-KI-VO „die Fähigkeiten, die Kenntnisse und das Verständnis, die es Anbietern, Betreibern und Betroffenen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Verordnung ermöglichen, KI-Systeme sachkundig einzusetzen sowie sich der Chancen und Risiken von KI und möglicher Schäden, die sie verursachen kann, bewusst zu werden.“
Bei der KI-Kompetenz geht es somit um den sachkundigen Einsatz von KI-Systemen im Bewusstsein ihrer jeweiligen Chancen, Risiken und Folgen. Diese Sachkunde muss in „ausreichendem Maß“ vorhanden sein. Ein ausreichendes Maß bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Mitarbeitenden in der Lage sind, die eingesetzten KI-Systeme sicher und regelkonform zu bedienen, Risiken zu erkennen und die rechtlichen Anforderungen einzuhalten.
Für Art und Umfang der zu vermittelnden KI-Kompetenz gibt es bisher keine Standard-Regelung. Allerdings plant die EU-Kommission bereits praktische Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Umsetzung dieser Anforderungen. Da die Vermittlung von KI-Kompetenz aber bereits jetzt eine gesetzliche Pflicht darstellt, sollten Unternehmen möglichst zügig aktiv werden, um diese Verpflichtungen einzuhalten.
Vorteile KI-Kompetenz
Die aktive Vermittlung von KI-Kompetenz hat verschiedene Vorteile für Unternehmen und Organisationen:
- Erfüllung von Sorgfaltspflichten:
Unternehmen können nachweisen, dass sie ihren Pflichten zur Schulung und Sensibilisierung nachkommen. Werden KI-Tools falsch genutzt oder kommst es zu rechtlichen Verstößen, können sie darlegen, dass sie vorab ausreichend Information und Aufklärung betrieben haben. - Prävention:
Mitarbeitende mit KI-Kompetenz sind sensibilisiert im Umgang mit KI. Sie kennen und verstehen die Konsequenzen bei Verstößen. Dies beugt Fehlverhalten vor. - Klare Standards:
Verbindliche Schulungen und interne Richtlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz schaffen klare Standards. Fehlverhalten kann so leichter identifiziert, und Konsequenzen gezogen werden. - Reduzierung von Missverständnissen:
Geschulte Mitarbeitende verstehen Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz besser. Sie haben eine realistische Erwartungshaltung an die Ergebnisse die KI-Systeme generieren. Dies steigert den sinnvollen Umgang mit KI-Tools und sorgt für einen Mehrwert der KI-generierten Arbeitsergebnisse. - Minimierung von Haftungsrisiken:
Geschulte Mitarbeitende haben Basiskenntnisse zu den rechtlichen Aspekten bei der Nutzung von KI. Unbeabsichtigtes Fehlverhalten und die Haftung des Unternehmens können dadurch reduziert werden. - Nachweis von Fahrlässigkeit oder Absicht:
Nachweise zu Schulungen und anderen KI-Kompetenz-Maßnahmen erleichtern die Unterscheidung zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Fehlverhalten. Verstößt jemand trotz Schulung und internen Richtlinien gegen Vorgaben, kann Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.
Wie kann KI-Kompetenz vermittelt werden?
KI-Kompetenz setzt sich in der Regel aus technischen Kenntnissen, Erfahrungen oder Schulungen zusammen. Dabei sind eingesetzte KI-Systeme, als auch Kenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Personen immer unterschiedlich. Die Vermittlung von KI-Kompetenz muss daher immer individuell auf die jeweilige Organisation, ihre Mitarbeitenden und die dort eingesetzten KI-Systeme angepasst werden muss.
Inhaltlich besteht KI-Kompetenz aus einer Mischung von technischem Wissen, rechtlichen Verständnis und ethischem Bewusstsein. Auch ein Gespür für Chancen und Möglichkeiten durch KI ist Teil der KI-Kompetenz. Diese Kenntnisse führen zu einer sicheren, effizienten und verantwortungsvollen Nutzung von KI im Unternehmen.
Da die KI-Verordnung keine konkreten Schritte oder Mittel zu Sicherstellung der KI-Kompetenz vorschlägt, sind verschiedene Maßnahmen denkbar, wie z.B.:
1.Teilnahme an externen Zertifizierungsprogrammen
2. Kooperationen mit Bildungseinrichtungen
3. Interne Fortbildungen und Schulungen
- Präsenzkurse
- E-Learning-Kurse
- Interne Praxisworkshops
4. Mentoring-Programme
5. Interner Wissensaustausch
- Organisation interner Wissensplattformen, wie z. B. Foren, in denen Mitarbeitende Erfahrungen und Best Practices teilen können.
- Gastvorträge oder Expertenrunden
- Communities of Practice
6. Regelmäßiges Feedback zu Schulungsmaßnahmen
7. Interne KI-Richtlinien und Standards
- Erstellung verbindlicher Leitlinien, die den Umgang mit KI-Systemen regeln und ethische sowie rechtliche Standards festlegen.
- Festlegung interner Best Practices
- Erstellung von Arbeitsanleitungen und Benutzungshandbüchern.
8. Benennung von KI-Beauftragten
In Anlehnung an den Datenschutzbeauftragten. Einrichtung von zentralen Ansprechstellen oder Teams, die für die Umsetzung und Überwachung von KI-Prozessen verantwortlich sind.
9. KI-Monitoring
Beobachtung der Entwicklungen auf dem KI-Markt und ggfs. Anpassung der KI-Strategie des Unternehmens.
(Vgl. Wybitul: Arbeitsbuch AI Act, 2025, S. 24)
Erste Schritte zur Förderung der KI-Kompetenz
Die Einführung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung der KI-Kompetenz sollte in mehreren Schritten erfolgen. Diese können z.B. folgendermaßen aussehen:
1. Bestandsaufnahme:
- Identifizierung der eingesetzten KI-Systeme.
- Identifizierung der aktuellen und zukünftigen Einsatzbereiche für KI.
- Analyse der Risiken und Gefahren der eingesetzten KI-Systeme
2. Analyse der Zielgruppen
- Ermittlung welche Personen mit welchem KI-System arbeiten (entwickeln oder nutzen).
- Ermittlung des aktuellen Kompetenzniveaus der jeweiligen Personengruppen und einzelnen Personen.
3. Entwicklung eines Schulungskonzepts:
- Konzept für Basisschulungen.
- Konzept für Führungskräfte-Schulungen.
- Konzept für fach- und aufgabenspezifischen Schulungen oder Maßnahmen.
(z.B. für Recht oder IT)
4. Auswahl von Schulungsinhalten:
- Festlegung von Schulungsinhalten je nach Zielgruppe
(Basisschulung, Führungskräfte, fach- und aufgabenspezifische Schulungen) - Technische Grundlagen von KI
- Rechtliche Aspekte
(z.B. KI-Verordnung, Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrecht, Haftung) - Ethik und Verantwortung
- Risiken und Gefahren
- Unternehmens- oder branchenspezifische Anwendungsfälle
5. Festlegung von Schulungsformaten:
- Präsenzschulungen
- Online-Kurse
- Hybride Schulungen
- E-Learning-Kurse
- Informelle Austausch-Formate:
- Interner Wissensaustausch
- Gast- und Expertenvorträge
- Foren, Chats
6. Evaluation und Weiterentwicklung:
- Regelmäßige Überprüfung aller KI-Kompetenz-Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung.
- Regelmäßige Aktualisierung der Schulungsinhalte, um neueste technische Entwicklungen, rechtliche Anforderungen und interne Einsatzmöglichkeiten mit aufzunehmen.
- Regelmäßige Auffrischungs-Schulungen und -Maßnahmen, um Kenntnisse zu vertiefen und Neuerungen zu Technik, Recht und Nutzung zu vermitteln.
KI-Kompetenz nachweisen:
Da die Befähigung der Mitarbeitenden mit KI-Kompetenz eine rechtliche Vorgabe für Unternehmen ist, müssen diese auch nachweisen können, dass sie dieser Verpflichtung nachgekommen sind. Nachweis über vermittelte KI-Kompetenz kann u.a. über die folgenden Maßnahmen erfolgen:
- Dokumentation von Schulungsmaßnahmen:
– Protokollierung aller durchgeführten KI-Kompetenz-Maßnahmen.
– Erfassung der vermittelten Inhalte, teilnehmenden Personen und Referenten oder Dozenten. - Tests:
Durchführung von Abschlusstests nach jeder Schulung
(zur Sicherstellung, dass die vermittelten Inhalte verstanden wurden). - Teilnahmebescheinigungen oder Zertifikate:
Vergabe von Zertifikaten oder offiziellen Nachweisen an Mitarbeitende nach Abschluss einer Schulung
(um deren Teilnahme und Lernerfolg zu belegen).
Fazit
Die Befähigung aller Mitarbeitenden mit KI-Kompetenz ist eine verpflichtende Anforderung für alle Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln, einsetzen oder nutzen. Wichtige Maßnahmen, um KI-Kompetenz zu vermitteln sind Schulungen, Austausch-Möglichkeiten und klare interne Regelungen zur KI-Nutzung im Unternehmen.
KI-Kompetenz sorgt für einen sicheren und ethischen Umgang mit künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag. Sie trägt dazu bei, falschen Umgang mit KI zu reduzieren und Risiken zu minimieren. KI-Kompetenz ist somit eine zentrale Fähigkeit, um künstliche Intelligenz sinnvoll und sicher in der täglichen Praxis zu verwenden.
Wir unterstützen Sie gerne beim Aufbau und der Durchführung der erforderlichen Schulungen und Maßnahmen zur KI-Kompetenz. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!
Weiterführende Links:
- KI-Verordnung auf EURLEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
- Ulbricht, Carsten: Praxsihandbuch KI und Recht. – Freiburg: Haufe, 2024
- Wendt/Wendt: Das neue KI-Recht. – Baden-Baden: Nomos, 2024
- Wybitul, Tim: Arbeitsbuch AI Act. – Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2025
* Dieser Beitrag dient der reinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar.